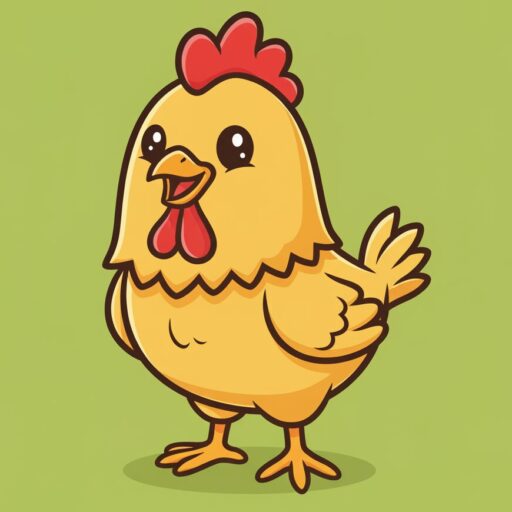Deutsches Langschan – Stolze Haltung, sanftes Wesen
Mit ihrer charakteristischen, leicht nach vorne geneigten Körperhaltung und dem ruhigen Temperament zählt das Deutsche Langschan zu den typischen Vertretern deutscher Hühnerrassen. Seit seiner Züchtung um 1879 vereint diese Zweinutzungsrasse norddeutsche Widerstandsfähigkeit mit einem sanftmütigen, folgsamen Wesen, das eine enge Bindung zu erfahrenen Haltern ermöglicht. Die markante, aufsteigende Rückenlinie verleiht ihr eine stolze Ausstrahlung, ohne forsches Auftreten – eine Balance aus Eleganz und Gelassenheit. Doch aufgrund spezifischer Ansprüche, etwa an die Platzgestaltung, ist sie nicht für Einsteiger geeignet. Für versierte Geflügelzüchterinnen und -züchter bietet sie dafür eine kälteunempfindliche Konstitution und ein harmonisches Temperament, das sich problemlos in bestehende Schläge integrieren lässt. Wer bereit ist, sich auf ihre Eigenheiten einzulassen, gewinnt eine ruhige Begleiterin mit bleibendem Charakter.
Wirtschaftlichkeit
160 pro Jahr
Gewicht Henne
2,7-3,2 kg
Gewicht Hahn
3,2-3,7 kg
Lebenserwartung
5–6 Jahre
Fleischansatz
Mittel
Bruttrieb
Schwach
Autosexing
Nein
Haltung & Gewichtsmanagement
Deutsche Langschan überzeugen durch ihr ruhiges Temperament und die bemerkenswerte Lernfähigkeit – sie gewöhnen sich schnell an menschliche Nähe und lassen sich gezielt an die Hand des Halters binden. Als soziale Gruppenmitglieder harmonieren sie problemlos mit anderen ruhigen Rassen, zeigen aber bei Stress oder Ablenkung eine typische Rassenpose: Bei Unachtsamkeit kippen sie den Körper nach vorne, hängen die Flügel durch und verlieren den charakteristischen hohen Stand. Ihr Aktivitätslevel ist moderat (5/10), sie durchstreifen den Auslauf zielgerichtet, ohne hektisch zu scharrten. Aufgrund ihres hohen Körpergewichts (Hennen 2,7–3,2 kg) sind Flugversuche selten – ein Zaun von 1,4 Meter reicht aus, um Ausbrüche zu verhindern. Aufgrund der komplexen Gewichtsregulation eignen sie sich nicht für Anfänger, da falsche Fütterung rasch die Legeleistung unter 160 Eier/Jahr drückt.
Haltung & Fütterung
Der Stallbedarf orientiert sich an der kompakten Körperbauweise: 1 m² pro drei Tiere sind das Minimum, bei reduziertem Auslauf jedoch unbedingt zu erhöhen, um Druck auf die Gelenke zu vermeiden. Besonders rassespezifisch ist die Verfettungsneigung der Hennen – ihr aufrechter Stand täuscht schlankes Erscheinungsbild vor, doch überschüssiges Futter setzt sich sofort in Körperfett um. Mastfutter ist tabu, stattdessen sollte die Ration kalorienarm sein und mit gezielt gestreuten Körnern im Auslauf kombiniert werden, um die Futtersuche zu aktivieren. Bei Hennen mit geringem Auslauf ist knappe Fütterung (max. 120 g/Tier/Tag) notwendig, um die Legeleistung zu stabilisieren. Die schweren Hähne dürfen nicht mit Mastfutter aufgepäppelt werden, da sie sonst Knochenprobleme entwickeln.Gesundheit & Besonderheiten
Typisch für die Rasse ist die Gewichtsabhängigkeit der Eiablage – bei nur 10 % Übergewicht sinkt die Leistung messbar. Externe Faktoren wie Kälte meistern sie problemlos (gute Rassenrobustheit), doch bei Hitze benötigen sie schattige Liegeflächen, da ihr dichtes Federkleid kaum Wärmeabgabe zulässt. Einzigartig ist die Körperhaltungsregulation im Ausstellungsbereich: Überforderte Tiere verlieren instinktiv die aufrechte Haltung, was durch gezieltes Training mit dem Züchter korrigierbar ist. Regelmäßiges Wiegen (monatlich) ist obligatorisch, um die Balance zwischen ausreichender Fütterung und Verfettungsprävention zu halten. Die flauschig befiederten Schenkel erfordern zudem eine trockene Unterlage, um Verfilzungen bei Nassfutter zu vermeiden.Platzbedarf & Klimaresistenz
Stallplatzbedarf
Normal
Auslaufbedarf
Hoch
Kälteresistenz
Gut
Charakter & Verhalten
Nutzung
Zweinutzungsrasse, Rassehühner
Farbschläge
schwarz, weiß, blaugesäumt, braunbrüstig
Charakter
ruhig, freundlich, sanftmütig, ausgeglichen, folgsam
Sozialverhalten
Außergewöhnlich friedlich
Aktivität
Ruhig
Lautstärke
Leise
Flugfähigkeit
Sehr gering
Geschichte des Deutschen Langschan
🇩🇪 Deutschland
1879
Das Deutsche Langschan entstand ab 1879 in Deutschland aus chinesischen Langshan-Hühnern, die 1872 zunächst nach England gelangten. Major A. C. Croad brachte die ursprünglichen Tiere aus dem nordchinesischen Distrikt Langshan nach Großbritannien, wo sie als Croad Langschan bekannt wurden. Deutsche Züchter modifizierten die raubeinige Urform gezielt durch Einbringung von schwarzen Minorca, Plymouth Rocks und Sumatra, um ein hochgestelltes, glattbeiniges Zweinutzungshuhn mit verbesserten Legeleistungen zu schaffen. Ab 1880 folgten weiße Orpington und Wyandotte für den gleichen Farbschlag. Bis 1895 etablierte sich das Deutsche Langschan als dominierende Zuchtform, während das englische Original an Bedeutung verlor. Der Rassestandard wurde 1904 definiert – mit gerader Rückenlinie, glatten Ständern und den typischen Farbschlägen Schwarz, Weiß, Blaugesäumt und Braunbrüstig. Auf der Hamburger Geflügelschau 1909 waren bereits 167 Exemplare ausgestellt, was den hohen Bekanntheitsgrad vor dem Zweiten Weltkrieg unterstreicht.
Bedeutung & Moderne Entwicklung
Während des Kaiserreichs und der Weimarer Republik war die Rasse als robustes Zweinutzungshuhn mit etwa 160 Eiern jährlich wirtschaftlich bedeutend. Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet sie jedoch nahezu in Vergessenheit. Erst ab 1982 setzte der Sonderverein der Langschanzüchter von 1895 e.V. gezielt auf den Erhalt dieser historischen Zuchtform. Heute zählt das Deutsche Langschan zu den kulturgutspendenden Rassen Deutschlands, bleibt aber insgesamt selten. Aktuelle Zuchtbemühungen konzentrieren sich auf die Bewahrung historischer Merkmale bei gleichzeitiger Anpassung an moderne Haltungsanforderungen, wobei besonders die traditionellen Farbschläge gepflegt werden.Bekanntheit & Status
Bekanntheit
Selten
Beliebtheit
Beliebt
Ausstellungsgeeignet
Ja
Häufig gestellte Fragen
Was ist das überraschende Merkmal der Körperhaltung beim Deutschen Langschan, und warum ist gezieltes Training dafür wichtig?
Die Deutsche Langschan zeigt eine markant aufrechte, leicht nach vorne geneigte Körperhaltung, die instinktiv bei Stress oder Ablenkung verloren geht – dann kippen sie den Körper nach vorne und hängen die Flügel durch. Diese Haltung muss den Tieren gezielt antrainiert und regelmäßig korrigiert werden, vor allem für Ausstellungen, da sie ein zentrales Rassemerkmal ist.
Wie beeinflusst das Körpergewicht konkret die Legeleistung der Deutschen Langschan, und welche Zahlen sind dafür entscheidend?
Schon eine Gewichtszunahme von nur 10 % über dem Idealgewicht senkt die Legeleistung deutlich unter das rassetypische Niveau von 160 Eiern jährlich. Deshalb ist monatliches Wiegen und eine exakt abgestimmte Fütterung (maximal 120 g/Tier/Tag bei wenig Auslauf) entscheidend, um die Leistung zu erhalten und Verfettung zu vermeiden.
Welche wenig bekannten Probleme kann das dichte Federkleid der Deutschen Langschan bei der Haltung verursachen?
Das flauschige Federkleid an den Schenkeln der Deutschen Langschan neigt bei feuchter Einstreu oder Nassfutter zur Verfilzung, was Hautreizungen und Infektionen begünstigen kann. Daher ist eine trockene Unterlage und gezielte Fütterung im Auslauf besonders wichtig – ein Insider-Tipp unter Züchtern.
Andere Rassen entdecken
Appenzeller Spitzhaube
Mit ihrer charakteristisch nach vorne geneigten Haube und dem lebhaften Wesen fällt die Appenzeller Spitzhaube selbst in...
🥚 150/Jahr
⚖️ 1,5-1,6kg
❄️ Kälteresistent

Brügger Kämpfer
Mit dem Brügger Kämpfer hält man lebendige Geschichte im Hühnerstall – eine Rasse, deren Wurzeln bis ins 17. Jahrhundert...
🥚 100/Jahr
⚖️ 3,5-4,0kg
🚫✈️ Flugfaul

Buckeye
Kaum eine Rasse vereint nordamerikanische Widerstandsfähigkeit und Gelassenheit so überzeugend wie das Buckeye. Als einz...
⚖️ 2,7-3,3kg
🚫✈️ Flugfaul